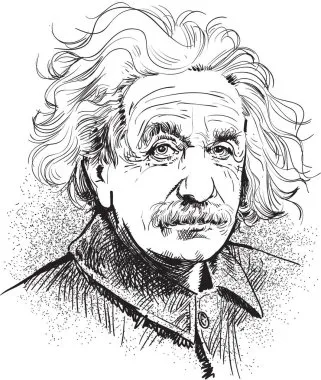Von Pierre-Alain Bruchez
Die Krise in der Wissenschaft, die die Forschung untergräbt, wird weitgehend unterschätzt, vor allem weil nicht reproduzierbare Ergebnisse, ideologische Voreingenommenheit, Interessenkonflikte und Betrug in der Regel isoliert diskutiert werden – ohne ihre kumulativen Auswirkungen und gemeinsamen Ursachen zu erkennen.
Wissenschaftler allein können dieses Problem nicht lösen. Die Kontrolle durch die Bürger ist unerlässlich. Aber zuerst müssen die Bürger informiert werden.
Wissenschaftlicher Betrug ist industrialisiert worden
Betrug ist von Natur aus schwer fassbar. Obwohl verbesserte Erkennungsinstrumente (z. B. Bildduplikationsanalyse) angesichts der schnellen Anpassungsfähigkeit von Betrügern möglicherweise Schwierigkeiten haben, aktuelle Betrugsfälle aufzudecken, liefern sie dennoch wertvolle Erkenntnisse über vergangenes Fehlverhalten.
Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass Betrug nicht mehr auf einzelne Personen beschränkt ist, sondern zunehmend von organisierten Netzwerken begangen wird (siehe Richardson et al., Die Einrichtungen, die wissenschaftlichen Betrug in großem Maßstab ermöglichen, sind groß, widerstandsfähig und wachsen schnell). Die Existenz von Betrügern sollte nicht einen ganzen Berufsstand diskreditieren, aber es bleibt die Pflicht jedes Berufsstandes, sie zu entlarven und auszuschließen.
Die Replikationskrise
Viele veröffentlichte Ergebnisse lassen sich nicht reproduzieren: Das ist die Replikationskrise. Das muss nicht unbedingt auf Betrug zurückzuführen sein. In vielen Bereichen sind die Ergebnisse statistischer Natur: Sie können auch auf Zufall zurückzuführen sein. Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, ob ein Würfel manipuliert ist, würfeln Sie ihn viele Male. Wenn eine Seite überproportional oft erscheint, kommen Sie zu dem Schluss, dass er voreingenommen ist.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Würfel fair ist und das Ergebnis lediglich zufällig ist. In der Regel wird ein Ergebnis akzeptiert, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig zustande gekommen ist, unter einem willkürlich festgelegten Schwellenwert von 5 % liegt (obwohl in einigen Bereichen, wie z. B. der Teilchenphysik, der Schwellenwert viel niedriger angesetzt ist).
Daher würde man grundsätzlich erwarten, dass 5 % der statistischen Ergebnisse falsch sind. In Wirklichkeit ist dieser Anteil jedoch viel höher, insbesondere aufgrund der Veröffentlichungsvoreingenommenheit. Spektakuläre Ergebnisse werden eher veröffentlicht, obwohl sie auch eher statistische Zufälle sind.
Bereits 2005 zeigte John Ioannidis in seiner bahnbrechenden Arbeit Why Most Published Research Findings Are False, dass der Anteil falscher statistischer Ergebnisse weit über 5 % liegt. Ein groß angelegtes Replikationsprojekt in der Psychologie bestätigte, dass nur eine Minderheit der Ergebnisse repliziert werden konnte. Auch in der Onkologie und der biomedizinischen Forschung sind die Replikationsfehlerquoten hoch. Überraschenderweise gibt es keine Metastudie, die die Replikationsfehlerquoten verschiedener Disziplinen vergleicht. Warum nicht ein groß angelegtes Replikationsprojekt für alle Fachbereiche starten?
Die Replikationskrise ist seit Jahren bekannt und immer noch nicht überwunden. Dabei könnte sie grundsätzlich schnell drastisch reduziert werden. Lösungen gibt es. Zeitschriften müssen Transparenz fordern: vollständige Offenlegung der Daten und Methodik, um eine Replikation zu ermöglichen. Methoden und Hypothesen sollten vorab registriert werden, um eine nachträgliche Hypothesenfindung zu verhindern. Artikel sollten aufgrund der Relevanz der Fragestellung und der methodischen Stringenz akzeptiert werden, nicht aufgrund der Ergebnisse.
Dies verringert den Anreiz und die Möglichkeit, statistisch fragwürdigen Ergebnissen nachzugehen. Das Center for Open Science bietet Tools zur Unterstützung dieser Vorgehensweise an, die jedoch nur in einer Minderheit der Publikationen verwendet werden.
Universitäten sollten mehr Studien replizieren, beginnend mit den wichtigsten (um die Grundlagen der Disziplin zu überprüfen) und nach dem Zufallsprinzip unter den neu veröffentlichten Ergebnissen (um Forscher zu mehr Rigorosität anzuregen, indem das Risiko erhöht wird, dass ihre Studie überprüft wird). Studenten würden wertvolle Erfahrungen sammeln und gleichzeitig einen äußerst nützlichen Dienst leisten. Replikation ist ein wirkungsvolles pädagogisches Instrument.
Initiativen wie die des Center for Open Science fördern die Replikation, sind aber im Vergleich zur globalen Forschungsleistung immer noch von bescheidenem Umfang. Der Replikationsstatus sollte bei der Konsultation einer Studie leicht zugänglich sein, und Journalisten sollten systematisch darüber berichten. Es müssen auch Schutzmaßnahmen getroffen werden, um kollusive Validierungsbetrugsfälle zu verhindern, bei denen Forscher selbstgefällig die Ergebnisse anderer reproduzieren. All dies sollte rasch umgesetzt werden.
Es ist ermutigend zu sehen, dass es immer mehr Initiativen gibt, die sich mit der Replikationskrise befassen. Neben dem bereits erwähnten Center for Open Science sind das Institute for Replication, Open Science NL und die Replication Initiative des NIH weitere bemerkenswerte Beispiele. Dennoch bleibt die Wirkung dieser Initiativen im Vergleich zum Ausmaß der Replikationskrise selbst bescheiden.
Die mangelnde Dringlichkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft bei der Bewältigung der Replikationskrise ist noch beunruhigender als die Krise selbst. Trägheit? Das tiefere Problem ist, dass für zu viele Wissenschaftler die Suche nach der Wahrheit nicht mehr oberste Priorität hat. Dies wird durch ihre zunehmende Unterwerfung unter autoritäre Ideologien deutlich.
Die ideologische Vereinnahmung an Universitäten offenbart eine Abkehr von der Suche nach der Wahrheit, was auch die Bemühungen zur Überwindung der Replikationskrise behindert. Umgekehrt hat sich die ideologische Vereinnahmung auf bereits geschwächtem Boden festgesetzt – wie die Replikationskrise selbst zeigt.
Ideologische Vereinnahmung
Große Universitäten, insbesondere in den USA, sind von autoritären Ideologien vereinnahmt worden. Ob freiwillig oder nicht, Forscher haben oft Behauptungen wiederholt, von denen sie wissen, dass sie falsch sind. Um diesen ideologischen Einfluss aufzudecken, gelang es Peter Boghossian, James Lindsay und Helen Pluckrose, absichtlich absurde, aber politisch korrekte Arbeiten zu veröffentlichen (sie präsentieren ihre Arbeit in einem Video). Boghossian musste von seiner Universität zurücktreten und gründete die University of Austin mit, die sich als eine der wenigen Alternativen zu den vom Wokeism vereinnahmten Universitäten positioniert.
Eine weitere Alternative ist die Peterson Academy, die von Jordan Peterson gegründet wurde. Er weigerte sich bekanntlich, sich unter einem kanadischen Gesetz zu einer bestimmten Rede zu verpflichten, erhielt Drohbriefe von seiner Universität in Toronto und trat schließlich zurück. Bret Weinstein, der sich gegen einen Tag der Abwesenheit aussprach, an dem Weiße gebeten wurden, den Universitätscampus nicht zu betreten, wurde ebenfalls gezwungen, zusammen mit seiner Frau zurückzutreten. Der Wokeismus breitet sich zunehmend auch auf europäische Universitäten aus.
So trat beispielsweise Professorin Kathleen Stock im Oktober 2021 von ihrer Position an der Universität Sussex zurück, nachdem sie aufgrund ihrer Ansichten zu biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität massiven Schikanen ausgesetzt war. Dies sind nur einige Beispiele, die die Macht veranschaulichen, die der Wokeismus innerhalb der Universitäten erlangt hat.
Die Schikanierung von Personen, die als politisch inkorrekt gelten, geht oft auf gemeinsame Lobbyarbeit bestimmter Studenten, Verwaltungsmitarbeiter und Wissenschaftler zurück. Wokeism kann nicht nur zum Rücktritt von Forschern führen oder die Einstellung inkompetenter Forscher (die nach anderen Kriterien als ihrer Leistung ausgewählt werden) erzwingen, sondern auch Forschungs- oder Lehrthemen vorschreiben oder verbieten oder die Art und Weise, wie diese Themen untersucht werden, verzerren (z. B. durch das Verbot der Untersuchung bestimmter potenzieller Ursachen eines bestimmten Phänomens). Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass viele Wissenschaftler der Suche nach der Wahrheit nur eine untergeordnete Priorität einräumen.
Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft formiert sich Widerstand. Eine Vielzahl akademischer Stimmen erhebt sich beispielsweise in The War on Science, herausgegeben von Lawrence Krauss (siehe auch ein Interview mit Krauss, in dem er das Buch vorstellt: Lawrence Krauss: The new war on science | UnHerd und Gespräche zwischen Krauss und Mitwirkenden des Buches auf der folgenden Website: The Origins Podcast). Es bleibt unklar, ob die am stärksten betroffenen Universitäten wiederhergestellt werden können oder durch neue, gesündere Institutionen ersetzt werden müssen.
Eine Korrektur des ideologischen Einflusses auf US-amerikanische Universitäten ist längst überfällig. Der Ansatz der aktuellen Trump-Regierung ist jedoch grob und undifferenziert. Es handelt sich nicht um eine Wiederherstellung des Gleichgewichts, sondern um den Aufstieg eines rechten Autoritarismus, der die Auswüchse des Wokeism widerspiegelt. Zwei Autoritarismen, die sich gegenseitig verstärken. Die Wissenschaft in den USA ist zwischen ihnen gefangen.
Die ideologische Vereinnahmung ist in Nordamerika am stärksten ausgeprägt, breitet sich aber auch anderswo aus, insbesondere in Europa (siehe zum Beispiel Frankreich: Face à l’obscurantisme woke). Angesichts des globalen Charakters der Wissenschaft führen zudem voreingenommene Forschungsergebnisse, die von amerikanischen Universitäten innerhalb einer bestimmten Disziplin veröffentlicht werden, letztendlich zu einer weltweiten Kontamination dieser Disziplin – zumal viele der renommiertesten Institutionen in Nordamerika ansässig und ideologisch vereinnahmt sind (laut dem 2025 U.S. College Free Speech Rankings von FIRE ist die Harvard University in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die am schlechtesten bewertete Hochschule in Bezug auf die Meinungsfreiheit).
Interessenkonflikte
Einige Forscher stellen ihren persönlichen Vorteil auf besonders eklatante Weise über die Wahrheit. So veröffentlichten beispielsweise 27 Wissenschaftler einen Brief in The Lancet, in dem sie diejenigen als „Verschwörungstheoretiker” bezeichneten, die vermuteten, dass COVID-19 aus einem Labor entwichen sein könnte, und damit die Debatte in der frühen Phase der Pandemie zensierten.
Zu diesem Zeitpunkt versäumten es mehrere Autoren, Interessenkonflikte offenzulegen, insbesondere Peter Daszak, der mit dem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hatte (und später von der WHO als einziger amerikanischer Vertreter in ihrem Team zur Untersuchung des Ursprungs von COVID-19 ausgewählt wurde).
Ich und vermutlich die meisten Bürger wussten vor der Pandemie nicht, dass Viren durch Funktionsgewinnforschung künstlich verstärkt wurden. Dies wirft eine beunruhigende Frage auf: Gibt es derzeit andere Verfahren, die ernsthafte Risiken bergen, aber der öffentlichen Kontrolle verborgen bleiben? Welche Rolle spielt der Wissenschaftsjournalismus, wenn er die Öffentlichkeit nicht über solche Gefahren informiert?
Warum ist es wichtig, woher COVID-19 stammt (siehe Bret Weinstein: Warum COVID-19 möglicherweise aus einem Labor entwichen ist | Joe Rogan Experience und Woher stammt COVID-19 WIRKLICH? Mit Matt Ridley | TRIGGERnometry)?
Erstens hätte die Kenntnis des Ursprungs von COVID-19 zu einem Zeitpunkt, als das Virus noch kaum verstanden war, wichtige Erkenntnisse über seine Eigenschaften liefern und möglicherweise zu einer effektiveren Ausrichtung früher Präventionsstrategien beitragen können.
Zweitens könnte das Verständnis der Einzelheiten des Unfalls, falls COVID-19 aus einem Labor stammt, dazu beitragen, wirksamere Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Drittens birgt das Ignorieren des Ursprungs der Pandemie die Gefahr, dass böswillige Akteure ermutigt werden: Wenn immer die Natur dafür verantwortlich gemacht wird, bleiben vorsätzliche Freisetzungen möglicherweise unbemerkt und ungestraft. Viertens sind wir es den Opfern schuldig, herauszufinden, was passiert ist.
Während der COVID-19-Pandemie erstreckte sich die Zensur und Dämonisierung derjenigen, die die offiziellen Narrative in Frage stellten, nicht nur auf den Ursprung des Virus, sondern auch auf die Wirksamkeit und Nebenwirkungen der getroffenen Maßnahmen, sei es in Bezug auf Lockdowns, das Tragen von Masken, Impfungen, Medikamente und so weiter.
Die COVID-19-Pandemie ist bei weitem nicht der einzige Fall, in dem Interessenkonflikte eine Rolle spielen. Diese Konflikte entstehen oft durch private Finanzierung. Geldgeber können Forscher beeinflussen oder einfach diejenigen auswählen, die am ehesten die gewünschten Ergebnisse liefern. Fakten sprechen in der Regel nicht für sich selbst. In einer Studie wurden verschiedenen Forschern identische Daten vorgelegt, um zwei Hypothesen zu testen: Ihre Schlussfolgerungen fielen sehr unterschiedlich aus. Die Wahl des richtigen Analysten kann also ausreichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Forscher können Daten oft so interpretieren, wie sie es wollen, getrieben von ideologischen, finanziellen oder karrierebezogenen Motiven.
Eine kaputte Wissenschaft braucht uns alle: Forscher, Journalisten und Bürger
Die Krise in der Wissenschaft hat viele Facetten, aber eine Ursache: Die Wahrheit wurde oft in den Hintergrund gedrängt. Viele Wissenschaftler arbeiten weiterhin rigoros und halten sich an die höchsten Standards, aber immer mehr Wissenschaftler stellen andere Ziele über die Suche nach der Wahrheit. Das sind keine echten Wissenschaftler mehr.
Wie andere Menschen reagieren auch Forscher auf Anreize. Sie wissen, dass ihre Karriere eher von der Anzahl ihrer veröffentlichten Artikel und der Häufigkeit ihrer Zitierungen abhängt als von ihrem wahren Wert. Sie spielen das Spiel mit. Wenn sie einen Artikel im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens begutachten, wissen sie, dass sie die Gültigkeit seiner Schlussfolgerungen nicht wirklich beurteilen können, es sei denn, es gibt offensichtliche Mängel.
Oft fehlen ihnen die Informationen, die für eine Wiederholung der Studie erforderlich sind, und außerdem haben sie wichtigere Dinge zu tun. Sie spielen das Spiel mit. Sie konzentrieren sich auf die Veröffentlichung von Artikeln und distanzieren sich vom Funktionieren ihrer Universität.
Wenn eine autoritäre Ideologie dies ausnutzt, um die Institution zu übernehmen, fügen sich die Forscher ihren Forderungen. Sie spielen das Spiel mit, genauso wie sie es taten, als sie ihre Forschung auf die Sicherung von Fördermitteln ausrichteten. Es gibt Ausnahmen, aber die Mehrheit der Forscher spielt ein Spiel, das nicht mehr auf die Wahrheit ausgerichtet ist.
Dabei brauchen wir dringend die Wissenschaft, um große Herausforderungen wie Klima, Energie und Gesundheit anzugehen. Aber die Wissenschaft kann diese Rolle nur erfüllen, wenn sie wiederhergestellt wird. Die Suche nach der Wahrheit muss wieder ihr zentraler Wert sein. Die wissenschaftliche Methode und die Meinungsfreiheit sollten wiederhergestellt werden.
Die Wissenschaft genießt dank ihrer Errungenschaften in der Vergangenheit nach wie vor hohes Ansehen. Unsere technologische Leistungsfähigkeit beweist, dass wir etwas über die Funktionsweise der Welt verstanden haben. Aber diese Errungenschaften der Vergangenheit sagen nichts über den aktuellen Stand der Wissenschaft aus, noch über Disziplinen, die nicht zur Technologie führen.
Wie kann die Wissenschaft wiederhergestellt werden? Trotz vielversprechender Initiativen hat die wissenschaftliche Gemeinschaft die Krise nicht überwunden. Dies deutet auf einen Mangel an Kapazitäten oder kollektivem Willen hin. Die Replikationskrise hält trotz verfügbarer Lösungen an. Schlimmer noch, viele Wissenschaftler an elitären US-Universitäten schließen sich autoritären Ideologien an.
Wissenschaftler werden die Wissenschaft nicht retten, wenn nicht die Bürger, die einen Großteil ihrer Forschung finanzieren und sich möglicherweise dafür entscheiden, sich nicht mehr von unwissenschaftlichen Studien irreführen zu lassen, sie zum Handeln zwingen. Diese Krise darf nicht weiter andauern.
Die Bürger müssen informiert werden. Das werden sie irgendwann auch. Aber je früher, desto besser, damit der Schaden schnell behoben werden kann.
Leider spielen Journalisten die Krise oft herunter, um den Ruf der Wissenschaft zu schützen. Indem sie versuchen, sie zu schützen, verzögern sie ihre Wiederherstellung und diskreditieren sich selbst. Wenn der Zusammenbruch nicht mehr zu verbergen ist, werden die Bürger fragen: „Warum haben Sie den Elefanten im Raum so lange versteckt?“ (Laut einer Studie haben beispielsweise 75 % der Deutschen noch nie von der Replikationskrise gehört). Und sie werden ihnen nicht mehr vertrauen.
Journalisten müssen jetzt ihre Stimme erheben, damit frühzeitig Hilfe kommt und Wissenschaftskommunikatoren nicht von einer Welle der Diskreditierung mitgerissen werden.
Es wäre sinnvoll, die Spieltheorie sowohl auf die Replikationskrise als auch auf die ideologische Vereinnahmung der Universitäten anzuwenden. Auf den ersten Blick sollte es möglich sein, die Spielregeln so zu ändern, dass die Anreize so ausgerichtet sind, dass sie der Replikationskrise entgegenwirken.
Die Bekämpfung der ideologischen Vereinnahmung von Universitäten scheint jedoch eher von rohen Machtverhältnissen abzuhängen. Es ist wichtig, die richtigen Hebelpunkte zu identifizieren. Ein solcher Punkt könnte darin bestehen, den Kreislauf des Virtue Signalling zu durchbrechen, indem man aufzeigt, dass Wokeism keine Tugend ist, sondern eine performative Verzerrung derselben.
Sich zu Wort zu melden kann die Mauer des Schweigens durchbrechen und andere ermutigen, es ebenfalls zu tun. Die Schaffung neuer, gesunder Institutionen kann ebenfalls einen Schneeballeffekt auslösen.
Nihilismus vermeiden
Die Tiefe der Krise kann schwindelerregend sein und zu Nihilismus führen. Doch wir haben einen Kompass: Die wissenschaftliche Methode dient dazu, sich der Wahrheit anzunähern. Das Problem ist, dass „Wissenschaftler” sie allzu oft aufgeben. Wir wissen, was zu tun ist. Und wir können Disziplinen und Institutionen vertrauen, die sich streng an die wissenschaftliche Methode halten.
Journalisten müssen dabei helfen, indem sie nicht nur über Ergebnisse berichten, sondern auch den Grad der wissenschaftlichen Strenge vermitteln, der dahintersteht. Zu diesem Zweck sollten wir versuchen, einen Index zu entwickeln, der die wissenschaftliche Strenge nach Disziplinen und Universitäten weltweit misst. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass die Entwicklung dieses Indexes nicht selbst vereinnahmt wird. Dieser differenzierte Ansatz ist unerlässlich, nicht nur um zu vermeiden, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, sondern auch um Disziplinen und Universitäten Anreize zu geben, zur wissenschaftlichen Strenge zurückzukehren.
Leider befassen sich die am wenigsten strengen Fachbereiche oft mit menschlichen Themen, bei denen Voreingenommenheit sowohl verlockender als auch leichter umsetzbar ist. Verlockend, weil sie die Politik beeinflusst. Leicht umsetzbar, weil die Komplexität mehr Spielraum für Manipulationen lässt.
Können wir, bis die Wissenschaft wiederhergestellt ist, der Wissenschaft in Fachbereichen und Institutionen mit geringer wissenschaftlicher Strenge noch vertrauen? Eine Antwort könnte sein, dass geringe wissenschaftliche Strenge immer noch besser ist als gar keine wissenschaftliche Strenge. Aber diese wissenschaftliche Strenge ist manchmal so gering geworden, dass sie meist irreführend ist, und es wäre besser, wenn diese Disziplinen und Universitäten sich nicht länger mit den Tugenden der Wissenschaft schmücken würden.
Grundlegende Skepsis, die Beweise verlangt und verstehen will, wie wir wissen, was wir wissen, ist grundsätzlich gesund und sogar zentral für den wissenschaftlichen Ansatz. Während der Wissenschaftskrise, die wir derzeit erleben, müssen die Bürger besonders wachsam sein. Ihr Vertrauen kann nur bedingt und granular sein. Bedingt von den vorgebrachten Argumenten und den Beweisen für die Einhaltung der wissenschaftlichen Methode. Granular: Das Vertrauen sollte je nach Disziplin und Institution variieren. Es geht nicht darum, alles, was sich als Wissenschaft ausgibt, einheitlich zu vertrauen oder zu misstrauen, sondern darum, Vertrauen auf der Grundlage der wissenschaftlichen Stringenz der Disziplin und der Universität, die die Ergebnisse präsentiert, zu gewähren. Und es ist nicht verboten, den gesunden Menschenverstand zu benutzen.
Wenn diejenigen, die die wissenschaftliche Methode verraten, sehen, dass sie die öffentliche Meinung nicht mehr beeinflussen können, werden sie unter Druck gesetzt, sich zu reformieren.
Selbstgefälligkeit vergiftet die Wissenschaft, die wir so dringend brauchen. Bürger, Journalisten und Wissenschaftler müssen jetzt handeln, um die Seele der Wissenschaft wiederherzustellen: die kompromisslose Suche nach der Wahrheit.