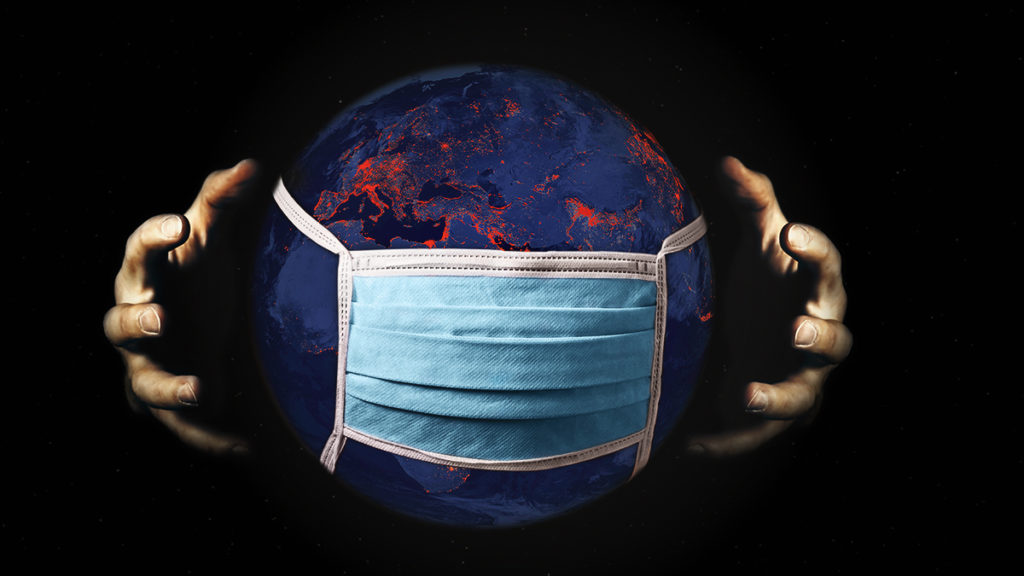Welche Konsequenzen entfalten die neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, die Deutschland mit einem Zustimmungsgesetz artig umsetzen will? Es herrschen Unklarheit und Intransparenz, doch Juristen lassen schon jetzt die Alarmglocken schrillen. Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ein Aushebeln des Einflusses nationaler Parlamente im “Krisenfall”, die autoritäre Technokratisierung des Gesundheitssystems: Rechtsexperten zeichnen ein düsteres Zukunftsbild.
Der folgende Beitrag ist eine Übernahme von Multipolar:
Berlin.(multipolar) Mehrere Juristen äußern sich besorgt über die Folgen der reformierten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die auch Deutschland mit einem eigenen Zustimmungsgesetz umsetzen will. So warnt etwa der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. In einem Interview mit den „Ärztinnen und Ärzten für individuelle Impfentscheidung“ (ÄFI) erläutert er, dass Deutschland gemäß den IGV verpflichtet sei, für eine „Verbesserung der Risikokommunikation“ zu sorgen. Wenn man Staaten jedoch aufgebe, „Fehlinformationen“ verhindern zu müssen, zwinge man sie „die Meinungsfreiheit viel stärker einzuschränken, als es zulässig ist“. Der Jurist befürchtet, dass in einem künftigen Informations-„Managementsystem“ die Unterscheidung zwischen Kritik und Desinformation „ganz schwierig“ werde.
Boehme-Neßler betont, dass es darüber hinaus nur „ganz wenig direkte Verpflichtungen“ gebe, die Deutschland mit dem Zustimmungsgesetz zu den IGV eingehe. Zwar gebe es „starke Machtzuwächse“ beim Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dieser könne aber trotzdem nur „Empfehlungen“ aussprechen und rein rechtlich in den einzelnen Staaten „nicht durchregieren“. Zugleich kritisierte der Jurist eine auf den rechtlichen Wortlaut beschränkte Sichtweise als „naiv“. Denn die „unverbindliche Empfehlung“ des Generaldirektors zeitige „im Pandemiefall“ politische und psychologische Wirkungen, die faktisch dazu führten, „dass diese Empfehlungen umgesetzt werden müssen“. Er halte es für „illusorisch“ anzunehmen, dass die nationalen Parlamente dann tatsächlich noch Einfluss nehmen könnten. „Das werden die nicht schaffen“, sagte er.
Darüber hinaus passt laut Boehme-Neßler die Reform der IGV zu einem „technokratischen Trend im Gesundheitswesen“ insgesamt. Der technokratische Ansatz sei weder wissenschaftlich noch demokratisch, sondern „autoritär“. Ein „Zentrum“ – die WHO beziehungsweise ihr Generaldirektor – erlasse Weisungen und Definitionen. „Und dann fängt die Maschine an zu laufen. Da ist dann kein Platz mehr für Neuüberlegungen, für abweichende Meinungen“, warnt Boehme-Neßler. Zudem sei der Ansatz nicht „effektiv, weil man nicht für jeden Staat dasselbe vorschreiben kann. Die Staaten sind unheimlich unterschiedlich.“
Die Juristin und Assistenzprofessorin Amrei Müller erkennt ebenfalls eine „Technokratisierung“. Auf Anfrage von Multipolar ordnet sie die Entwicklung allerdings in den noch größeren Kontext der „Securisation“ ein, was mit dem Begriff „Militarisierung“ übersetzt werden kann. Diese habe ihren Ursprung in der biologischen Kriegsführung. Müller weist darauf hin, dass der internationale Rechtsrahmen und der Ansatz der WHO von der „Globalen Doktrin der Gesundheitssicherheit“ dominiert sei. Dies sei schon der Fall gewesen, bevor die IGV 2024 geändert wurden. Der „technokratische Trend“ sei daher „keinesfalls“ neu. Bereits in den 1990er Jahren habe sich ausgehend vom US-amerikanischen Recht das Konzept „Gesundheitsnotstand“ im internationalen Recht etabliert. Die Juristin erinnert daran, dass die IGV bereits zwischen 1995 und 2005 „gründlich revidiert“ wurden.
Auch die Juristin Beate Sibylle Pfeil verweist auf den größeren Kontext. In ihrer Stellungnahme zum Entwurf des IGV-Zustimmungsgesetzes arbeitet sie mehrere grundsätzliche „Strukturprobleme“ der WHO heraus. Dazu zählt sie unter anderem die „Intransparenz“ der Organisation. In ihrer „Offenlegungspolitik“ verweise die WHO zwar auf ihre Rechenschaftspflicht, an den entscheidenden Stellen, wie etwa bei der Offenlegung von Interessenskonflikten oder Spenderverträgen, blieben wichtige Informationen jedoch meist unter Verschluss. Die „vorherrschende Intransparenz“ verschärfe das „bereits vorhandene Fremdbeeinflussungs- und Fremdsteuerungspotential“ und führe insgesamt „zu einem Mangel öffentlicher Kontrolle“. Auch gegenüber Multipolar verweigerte die WHO jegliche Auskunft zur praktischen Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften.
Multipolar wollte insbesondere wissen, ob und inwiefern sich die Mitgliedsländer im Zuge der reformierten IGV am Aufbau des weltweiten „Notfallkommandos für Globale Gesundheit“ (Global Health Emergency Corps) beteiligen müssen. Die geplante Struktur, an deren Umsetzung bereits gearbeitet wird, sieht eine globale Vereinheitlichung und „Kompatibilität“ des Gesundheitspersonals vor. Führungskräfte sollen sich kontinuierlich in transnationalen Netzwerken organisieren und abstimmen. Ein wichtiger Knotenpunkt ist die WHO mit einer „kleinen Gruppe von Experten“. Inspiriert ist dieses Konzept unter anderem von Bill Gates. Es sieht explizit auch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) vor, etwa zur „optimierten Überwachung“, beim „Personalmanagement“ oder zur „prädiktiven Analyse von Gesundheitsnotfällen“. Fragen zur konkreten Anwendung von KI lässt die WHO ebenfalls unbeantwortet.
Auch das Robert Koch-Institut (RKI) will sich nicht zur praktischen Umsetzung der IGV und des „Notfallkommandos für Globale Gesundheit“ äußern. Auf Anfrage von Multipolar erbat sich das Institut zunächst mehr Zeit, verwies dann jedoch auf die Pressestelle der WHO. Dabei ist in Deutschland die kommissarische Vizepräsidentin des RKI, Johanna Hanefeld, federführend zuständig für das „Notfallkommando“. Aus einem WHO-Papier geht zudem hervor, dass die WHO derzeit mit „Vorreiterländern“ („pathfinder countries“) zusammenarbeitet, die etwa „Lücken für weitere Investitionen identifizieren“ sollen. Ob auch Deutschland zu den „Vorreiterländern“ gehört, will das RKI nicht sagen. Ebenso verweigert das Institut Angaben zu weiteren möglicherweise verantwortlichen Personen und involvierten Institutionen, auch im Hinblick auf die Umsetzung der IGV. Das Institut teilt nach mehrfachen Nachfragen schlussendlich mit: „Das Thema, zu dem Sie Fragen haben, ist noch in der Diskussion.“
Update 22.10.: Nach Veröffentlichung der Meldung teilte das RKI mit: „Es handelt sich beim GHEC um ein Konzept, das in erster Linie von der WHO erarbeitet wird. Die Inhalte sind noch nicht final festgelegt, es sind keine Aufgaben verpflichtend vergeben oder umgesetzt worden. Es ist dem RKI zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich, ob dies erfolgen soll.“
Autoritarismus, Zensur, Militarisierung: Juristen warnen vor WHO-Gesundheitsvorschriften